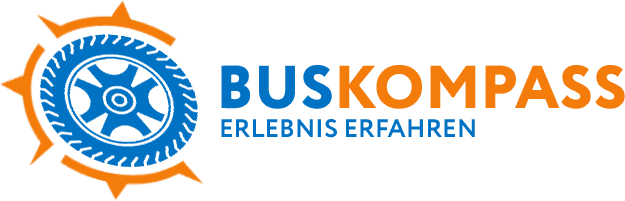In der Hafenstadt an der Elbe gibt es viel zu entdecken. Hier weht immer ein frischer Wind und es herrscht Weltoffenheit und hanseatische Eleganz. Die Elbphilharmonie und das größte deutsche Sprechtheater, das Deutsche SchauSpielHaus, spielen bei jedem Wetter.
Die Elphi, so wird sie liebevoll genannt. Bei der Einfahrt übers Wasser per Schiff und von vielen Orten in Hamburg kann man die Elbphilharmonie plötzlich unvermittelt erblicken. In nur kurzer Zeit nach ihrer Einweihung im Jahre 2017 ist sie zum Symbol für die Stadt geworden und Menschen aus nah und fern freuen sich an ihrem Anblick. Die Elphi bietet für jeden etwas: natürlich Musik aller Sparten, mit erstklassigen Solisten und Ensembles aus aller Welt, aber auch sehen und gesehen werden. Und es gibt vieles zu entdecken. Der Elbphilharmonie-Besuch ist ein besonderes Erlebnis für alle Sinne, wie die Elphi über sich sagt. Im Großen Saal zum Beispiel im doppelten Sinne: Welche Konzerthaus kann schon von „rund und um die Bühne terrassenförmig emporwachsenden Zuschauerrängen“ schwärmen? Oder dass „die Akustik von Yasuhisa Toyota jeden Ton glasklar hörbar macht“?
Auf dem Weg durch den Komplex kann man aus jedem Fenster neue und interessante Aussichten entdecken, die je nach Licht und Wetter wechseln. Denn die beiden Schweizer Architekten Herzog und de Meuron setzten dieses Konzerthaus mitten in den Strom der Elbe.
Das Fundament: ein Backsteinspeicher aus den 1960ern mit einer Kristallwoge als Überbau. Besucher können bei freiem Eintritt den einzigartigen Ausblick genießen: eine öffentlich zugängliche Aussichtsplattform legt die Basis für Streifzüge durch die Umgebung.
Im Inneren wird der Tastsinn besonders angesprochen. Im Unterschied zu anderen Konzerthäusern darf hier ertastet werden, wie ein Klang sich anfühlt. So heißt es auf der eigenen Webseite explizit: „Die besonderen Materialien im Inneren laden zum Ertasten ein, die akustische Wandverkleidung im Großen und im Kleinen Saal dürfen angefasst werden. Dies ist auch in der Elbphilharmonie Instrumentenwelt ausdrücklich erwünscht. In den Kaistudios können Instrumente aus aller Welt ausprobiert werden.“ Wer sich also immer schon an Gamelanmusik versuchen wollte, kann es hier tun.
Nach viel Streit und Protesten – die Fertigstellung verzögerte sich über viele Jahre durch besondere Umstände am Bau und hohe Überschreitung der ursprünglich veranschlagten Kosten – hat das Haus nach jetzt Symbolcharakter für Hamburg.

Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in der Hansestadt: den Fischmarkt in Altona, den Hafen, die Reeperbahn, die Hauptkirche St. Michaelis, Michel genannt, sowie wunderbare Parks wie Planten un Blomen und den Jenischpark. Allerdings: Ihr Herz schlägt für zeitgenössische Theaterformen? Das DeutscheSchauSpielHaus mitten in Hamburg gleich neben dem Hauptbahnhof bringt immer wieder bekannte Namen auf die Bühne: Edgar Selge, Maria Schrader, Lina Beckmann und Charly Hübner, um nur einige zu nennen, und hat sich innerhalb der deutschsprachigen Theaterszene zu einem Vorreiter, einer Vorreiterin entwickelt.
Heute gehört das Deutsche SchauSpielHaus in Hamburg zu den schönsten Theaterbauten Deutschlands. Es ist mit seinen 1200 Plätzen auch eins der größten. An seiner 120-jährigen bewegten Geschichte lässt sich der historische Verlauf der Bundesrepublik und ihrer Vorgängerstaaten ablesen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es auf private Initiative des Theaterkritikers Heinrich E. Wallsee und des Vereins „Hamburger Bürger zu St. Georg“ errichtet. Vorbild war das Wiener Burgtheater. Die „Aktiengesellschaft Deutsches Schauspielhaus“ wurde im Juni 1899 von 84 Teilhabern, überwiegend Hamburger Finanziers und Kaufleute, gegründet. Erster Intendant wurde der bedeutende Wiener Literaturprofessor Alfred von Berger. Für den Theaterneubau wurden die über die Grenzen Österreichs planenden Wiener Architekten Ferdinand Fellner und Hermann Helmer beauftragt. Das Ergebnis lehnte sich mit seiner neobarocken Gestalt an das Wiener Volkstheater an. Das DeutscheSchauSpielHaus folgt hier ganz bewusst der Tradition des Nationaltheater-Projektes aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Auch hier unterstützten reiche Hamburger Bürger und ein gewisser Gotthold Ephraim Lessing die Bühne.
Die weitere Geschichte entspricht der vieler Privattheater während des Ersten und Zweiten Weltkriegs: die Konkurrenz durch andere Unterhaltungsformen wuchs. Schon vor der Gleichschaltung 1934 kam es zu erheblichen Angriffen durch NSDAP-Mitglieder, die schon Ende der 20er Jahre methodisch damit anfingen, Aufführungen zeitgenössischer Werke zu stören. Direkt nach der Gleichschaltung wurde damit begonnen, alle jüdischen und für jüdisch gehaltenen Mitarbeiter zu entlassen. Im September 1944 wurden dann alle Theater Deutschlands endgültig geschlossen. Das Schauspielhaus wurde zur Rüstungswerkstatt. Theater gab es dann wieder nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit Gustaf Gründgens, Intendant von 1955 bis 1963, schrieb das Schauspielhaus Geschichte: sein Faust aus dem Jahre 1957 wurde zum „Hamburger Faust“ und damit unsterblich.
Spätere Intendanten lösten sich von Vorgaben und Traditionen.
Peter Zadek zeigte sich als ein Theatererneuerer.
Frank Baumbauer brachte das Schauspielhaus mit zeitgenössischen Themen und Aufführungen an die Spitze der deutschsprachigen Theater.
Mit Karin Baier übernahm 2013 erstmals eine inszenierende Intendantin die Leitung des Hauses. Beim Publikum überaus erfolgreich war sie unter anderem mit ihrer Inszenierung von Michel Houellebecqs Roman „Unterwerfung“, ein Solo-Stück mit Edgar Selge. Die 1965 geborene Theaterfrau ist mehrfach höchst preisgekrönt, so 2006 mit dem österreichischem Theaterpreis „Nestroy“ und 2009 mit dem deutschen Theaterpreis „DER FAUST“.
In einem Interview mit dem NDR im April 2020 sagte sie: „ Ich habe ein schönes Angebot aus München und ein schönes Angebot aus Berlin, aber ich reagiere einfach sehr stark auf Gebäude, und das Hamburger Schauspielhaus ist nicht zu toppen.“