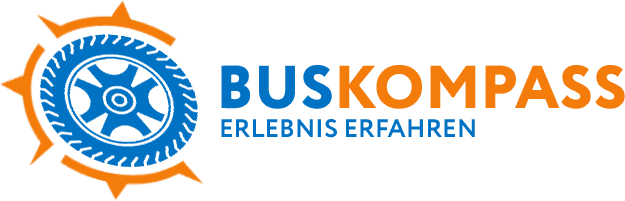Wo gibt es in Berlin ein Theater für alle?
Was zeigt das kleinste der Berliner Staatstheater, das Maxim Gorki Theater?
Was liegt in einer Nische hinter der Straße Unter den Linden?
Das Maxim Gorki Theater macht Theater für die ganze Stadt – für alle, die in den letzten Jahrzehnten dazugekommen sind, ob durch Flucht, Exil, Einwanderung oder durch das Aufwachsen in Berlin. Heterogenität, Vielfalt, ist ausdrücklich Programm. Künstlerische produktive Auseinandersetzung mit der ganzen Stadt, nicht nur mit kleinen Grüppchen ist das Ziel, besonders seit Shermin Langhoff und Jens Hillje 2013 die Intendanz übernommen haben. Die meisten Schauspieler haben einen Migrationshintergrund. Der Anteil der jungen Zuschauer im Publikum ist hoch.
Das in das Theater integrierte Studio R ist „Kunstasyl für marginalisierte Themen und Denkweisen, Plattform für Diskussionen und Schaffensprozesse“. Hier finden also Themen Platz, die „noch“ nicht im großen Rahmen Thema in Gesellschaft und Kunst sind. Ebenso ist das Gorki Forum ein Ort, an dem laut gedacht werden kann, es Auseinandersetzungen geben darf und um das beste Argument gerungen wird – Demokratie gelebt werden kann. Das Gorki Forum begreift sich als Schnittstelle zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik und hier wird der produktive Umgang mit gesellschaftlicher Heterogenität, der Vielfalt gearbeitet.

Der Journalist Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur der großen türkischen Zeitung Cumhuriyet, der in Deutschland politisches Asyl fand, hat im Maxim Gorki Theater eine regelmäßige Kolumne, die auf der Internetseite des Hauses zu lesen ist.
Eine Probe zu Nachtasyl von Maxim Gorki
Als ich in den 70er Jahren, so im Alter von siebzehn Jahren erstmals alleine ins Theater ging – ich lebte in Berlin – entdeckte ich auch das Maxim Gorki Theater. Irgendwoher, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, wurde ich zu einer Probe eingeladen. Die Theaterleute wollten Schüler auf der Probe haben, um zu testen, wie das, was sie spielten, beim Publikum, bei Jugendlichen ankam. Ich fand es sehr aufregend, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, hinter die Kulissen zu schauen. Zum ersten Mal war ich zusammen mit einigen interessierten Mitschülern dabei, wie ein Theaterstück entsteht. Geprobt wurde Nachtasyl von Maxim Gorki. Das Stück spielt in einem Obdachlosenasyl und ist das bekannteste und erfolgreichste Stück des Autors. Die Uraufführung war 1902.
Wir waren also am Abend um 18 Uhr ins Maxim Gorki Theater eingeladen und trafen uns dazu am Bühneneingang. Das ist der geheimnisvolle Eingang, durch den die Theaterleute ins Theater zu ihrer Arbeit gehen. Eine Pförtnerloge befindet sich daneben. Hier kann man zum Beispiel Briefe, Nachrichten oder Blumen für die Künstler hinterlegen. Andererseits geben hier Theaterleute Schlüssel oder ähnliches ab. Die Pforte eines Theaters ist ein geheimnisvoller, aber auch klar strukturierter Drehpunkt, durch den wir nun in verschlungenen Pfaden und Gassen zur Probebühne gelangten. Die Probe war sehr interessant. Vergleichbares hatte ich noch nie gesehen. Schauspieler wie Uwe Kockisch – heute bekannt aus dem Fernsehen in den Verfilmungen der Krimis von Donna Leon als Commissario Brunetti – waren damals ebenso dabei wie Udo Schenk, der heute Doktor Kaminski in der ARD- Serie In aller Freundschaft spielt. Ausserdem Swetlana Schönfeld und Klaus Manchen, beide bekannte Berliner Schauspieler. Auch wenn sie heute im Fernsehen berühmt sind, so ist doch das Theater der Ursprung ihrer Kunst und ihres Könnens. Für mich war diese Probe von Nachtasyl ein emotionaler Einstieg ins Theater. Es war faszinierend zu sehen, wie Menschen einen Text zum Leben erweckten, sich dabei immer wieder unterbrachen, nachdachten, neu anfingen, wieder unterbrachen, etwas besprachen und wieder neu anfingen. Ich spürte ein besonderes Flirren in der Luft, Gedanken und Worte bewegten sich durch den Raum. Ich konnte sie quasi fliegen sehen. Das alles bei großer Ruhe und Konzentration. Es war toll.
Die Übergangsgesellschaft von Volker Braun
Später Ende der achtziger Jahren erlebte ich eine Aufführung des Maxim Gorki Theaters von Die Übergangsgesellschaft von Volker Braun beim West-Berliner Theatertreffen. Ich lebte mittlerweile im Westen, in Süddeutschland. Diese Aufführung war zum berühmten Theatertreffen eingeladen worden, wo jeweils die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen einer Saison von einer Jury ausgewählt und in Berlin gezeigt werden. Ich war glücklich, die letzte Karte ergattert zu haben! Ich sah eine Neuerzählung des Stoffes der Drei Schwestern von Anton Tschechow. Menschen treffen sich – hier zu einer Geburtstagsfeier, erzählten und träumen von einem besseren Leben. Die Handlung des Stückes spielt in der DDR in den siebziger Jahren. Durch diese vielen Handlungsebenen, die sich gegenseitig spiegelten, war das Stück sehr spannend und auch in West-Berlin ein großer Erfolg. Uwe Kockisch, Swetlana Schönfeld und Klaus Manchen waren wieder mit dabei. Das Stück war eine Art Abgesang auf die DDR. Denn 1989 fiel die Mauer.
Das historische Haus der Berliner Singakademie
In der Mitte Berlins, nur wenige Schritte hinter der berühmten Straße Unter den Linden, direkt hinter der Neuen Wache, zwischen der Humboldt Universität und dem Palais am Festungsgraben findet man das Maxim Gorki Theater, das sich seit seiner Gründung 1952 als zeitgenössisches Stadttheater in historischer Umgebung versteht. Man kann sagen, dass die heutige Theaterarbeit in der Tradition von Maxim Gorki steht, der sich aus der Armut heraus als Autodidakt zu einem weltbekannten Schriftsteller entwickelt hat, der für die Armen und Entrechteten einstand.
Zum Theater gelangt man auch mit einem Bus. Die Kantine des Maxim Gorki Theaters ist montags bis samstags von 9 bis 24 Uhr für alle geöffnet.
Das gesamte Haus ist barrierefrei. Begleitpersonen eines Rollstuhlinhabers bekommen – wie übrigens an allen anderen Berliner Theatern auch – nach Anmeldung freien Eintritt.
Das Gebäude selbst besteht seit 1827 und wurde von Karl Friedrich Schinkel für die Berliner Singakademie als Konzertsaal gebaut. Hier wurde Ostern 1829 die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach durch Felix Mendelssohn Bartholdy neu entdeckt und wieder aufgeführt.