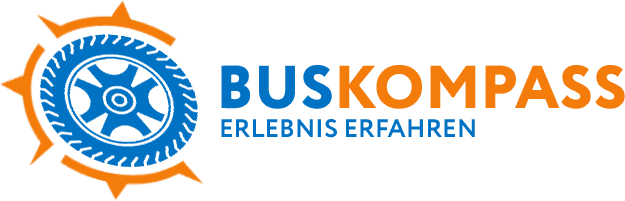Der Wiederaufbau des Berliner Schlosses war lange umstritten. Jetzt steht es als Humboldt Forum wieder da und ist seit Juli 2021 offen für alle.
Als ich ein Kind war, wurde in der Mitte Berlins von 1973 bis 1976 der Palast der Republik gebaut. Als Kind und besonders als Jugendliche ist man empfänglich für Neues – und so freute ich mich, dass das neue Haus im April 1976 eröffnet wurde und war neugierig darauf. Ich war mitten in der Lehre als Baufacharbeiterin mit Abitur beim VEB Tiefbau Berlin, verdiente eigenes Geld und bei einem Abstecher in „die Stadt“ besuchten wir den Palast. Vergleichbares hatte ich noch nie gesehen. Im Hauptfoyer standen große, breite, bequeme rote Ledersofas und an den Wänden waren sechzehn Monumentalgemälde von damals etablierten Künstlern wie Willi Sitte, Wolfgang Mattheuer, Walter Womacka und anderen zu enträtseln. Unter dem Titel „Dürfen Kommunisten träumen?“ spiegelten sie die kulturpolitische Öffnung der DDR in diesen Jahren. Es schien mir interessant. In den Lokalen des Palastes wie der Espressobar, dem Jugendtreff und der Weinstube fanden wir Platz – und da Kneipen, auch für Jugendliche bezahlbare, in Berlin-Mitte immer Mangel waren, freundete ich mich mit dem neuen Gebäude an. Ich denke, so ging es manchem. Es entstanden lustige Spitznamen für das Haus wie „Palazzo Prozzo“ und „EDEKA: Erichs Datsche am Kanal“, „Erichs Lampenladen“ und „Ballast der Republik“ – weil der Bau viel gekostet hatte und Geld und Material jetzt woanders fehlten. Dass genau auf diesem Platz mal das Berliner Schloss stand, war mir nicht klar – und viele hatten es vergessen.
Die Zeit verging und ich zog in den Westen und dann weiter nach Süden. Die Mauer fiel und 1990 wurde der Palast, noch auf Anweisung der Regierung der DDR, wegen Asbestverseuchung geschlossen. Eine Sanierung sollte Millionen kosten, der Abriss natürlich auch. Da das Gebäude nicht unter Denkmalschutz stand, „zerbröckelte“ es immer mehr und wurde zerstückelt – es gab viele Diskussionen zum Erhalt und der Umnutzung. Auch wenn man das Gebäude an sich nicht schön fand, sondern hässlich – so war es doch ein Zeitdokument, ein Zeugnis der DDR mit dem sich viele Menschen identifizierten. Der Palast hatte Identität gestiftet. Intellektuelle warnten davor, alle Spuren der DDR und der Geschichte zu verwischen. Ebenso wie die Berliner Mauer, die nach und nach aus dem Berliner Stadtbild verschwand, wurde der Palast der Republik ab Februar 2006 abgerissen. Dreißig Jahre hatte er gestanden. Die DDR wurde einundvierzig Jahre.
Eine Insel in der Spree

Foto: © Karin Frucht / comkomm
Seit 1451 wohnten an diesem Ort im Berliner Schloss Kurfürsten und Könige der Hohenzollern. Vor 1150 war dort eine Wiese in der Flusslandschaft zwischen zwei Armen der Spree. Von 1300 bis 1536 entstand ein Kloster, ab 1538 ein Renaissance Schloss. Von nun an war das Schloss der feste Sitz der Könige, der Gerichte und der obersten Behörden. Nach Ende des 30jährigen Krieges gab es einen Aufschwung. Als Kurfürst Friedrich III. 1701 König in Preußen wurde – er hatte sich selbst in Königsberg gekrönt – ließ er das Schloss vom Architekten Andreas Schlüter in ein Barockschloss nach italienischem Vorbild umbauen. Eosander von Göthe vollendete diesen Bau, der als Hauptwerk des norddeutschen Barock gilt.
Und nun, weil der Text auch ein persönlicher ist: mein Urgroßvater Adolf von Harnack, ein bedeutender Theologe und Wissenschaftsorganisator seiner Zeit, Gründer der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, war ab 1901 regelmäßig zum Tee bei Kaiser Wilhelm II. im Schloss eingeladen. Der Kaiser schätzte den intellektuellen Austausch mit ihm, lud Harnack dann besonders gern ein, wenn Dritte dabei waren. Der Kaiser war vielen Themen gegenüber aufgeschlossen, zugleich war er „liebenswürdig“ und ein „ritterlicher Hausherr“.
Er beharrte darauf, das Gespräch zu führen, sich mitzuteilen und das Gegenüber zu belehren, sein Gottesgnadentum. „Hinter den Wällen die diesen Besitz hüteten, ließ er niemanden etwas antasten und er war unbeeinflussbar.“ Diese Sturheit bei gleichzeitiger Aufgeschlossenheit beschreibt Agnes von Zahn in ihrer Biografie über Harnack.
Auch das alles wusste ich nicht, als ich 1976 Lehrling bei Tiefbau Berlin war und das Schloss seit sechsundzwanzig Jahren nicht mehr stand.
Während der Weimarer Republik beherbergte das Schloss Museen und andere Institutionen. 1945, bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg wurde es nahezu völlig zerstört. Ein Wiederaufbau wäre allerdings möglich gewesen. Nach einigem Hin und Her wurde das Berliner Schloss auf Befehl Walter Ulbrichts am 7. September 1950 gesprengt. Fünfhundert Jahre preußischer Geschichte sollten nicht mehr im Blickpunkt stehen. Die dies miterlebt hatten, waren und blieben entsetzt. Die junge DDR wollte einen zentralen Aufmarschplatz für Kundgebungen mitten in der Stadt.
Kloster, Schloss, Aufmarschplatz, Palast der Republik, Wiese

Foto: © Karin Frucht / comkomm
So waren im neuen Jahrtausend viele ältere Berliner, die das Schloss aus ihrer Kindheit und Jugend kannten, für den Wiederaufbau des Berliners Schlosses. Andere Stimmen meinten, dass eine Rekonstruktion eines so zentralen Gebäudes ungut sei – da man die Zeit nicht zurückholen kann. Geschichte ist kein Bastelbogen und Widerspüche werden nicht durch Holz, Farbe und Leim überwunden.
Dennoch wurde im Juni 2013 der Grundstein für den Wiederaufbau gelegt. Zuvor war der Platz wieder zu einer Wiese geworden. Meine Freundin Moni meint, dies wäre die beste Variante gewesen: Natur und eine freie Fläche mitten in der Stadt.
Die Initiative eines ursprünglich einzelnen Kaufmannes, Wilhelm von Boddien, hatte sich durchgesetzt. Die Barockfassaden der alten Gebäude wurden wieder aufgebaut, an der Spreeseite ein Entwurf des Architekten Franco Stella umgesetzt. In Anlehnung an die Brüder Humboldt, ihrer Weltoffenheit und ihrem Forschergeist bekam das Gesamtensemble den Namen Humboldt Forum.
An kaum einem andern Ort in Berlin haben sich städtebauliche, politische, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen so verdichtet wie auf dem Schlossplatz. Hier haben Fürsten, Könige und Politiker in den letzten 800 Jahren gebaut, umgebaut, abgerissen und immer wieder neu geplant, um ihren Ideen Ausdruck zu verleihen und ihre Macht zu festigen. Machen Sie sich selbst ein Bild! Die Anreise mit dem Bus ist einfach.
Das Humboldt Forum schließt die Lücke in der historischen und kulturellen Mitte Berlins. Wo bis vor kurzem scheinbar nichts war, dann eine Wiese – ist nun wieder ein öffentlicher Platz und Treffpunkt. Vielstimmigkeit ist ausdrücklich Programm. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit zwei Museen, Kulturprojekte Berlin, das Stadtmuseum Berlin, die Humboldt-Universität und die Stiftung Humboldt Forum sind nun unter einem Dach im Berliner Schloss vereint.
Das Universalmuseum beherbergt nun die Sammlungen des ethnologischen Museums und des Museums für asiatische Kunst sowie eine Berlin-Ausstellung und widmet sich in einem Videopanorama ausführlich der Geschichte des Ortes. Derzeit gibt es neue Sichtweisen und Diskussionen um Raub- und Beutekunst von Objekten in den ethnologischen Sammlungen und die Frage der Rückführung in die Länder, aus denen die Kunstschätze einst mitgenommen, entwendet wurden. Es gibt vieles zu entdecken!
Das Lebenswelten Bistro und vier weitere Cafés und Restaurants arbeiten ökologisch nachhaltig und bieten ein umfangreiches, auch preiswertes Angebot für alle und jeden Geschmack. Geboten wird Berliner und Brandenburger Küche wie Buletten und Königsberger Klopse, aber auch Internationales wie Zitronengras Gemüsesuppe, Couscous und Taboulé.
Das gesamte Schloss ist barrierefrei zugänglich.
Bis einschließlich 12. November 2021 ist der Eintritt in sämtliche Ausstellungen frei.
Link
Literatur
Agnes von Zahn: Adolf von Harnack, De Gruyter Berlin, 1951, Seiten 261 ff